Zeitleiste
bis 1076
Die gesamte Oberlausitz stand unter Einflussgebiet der Mark Meißen und gehörte zum Deutschen Reich.
1076 bis 1253
Die Oberlausitz wurde Lehngebiet um 1200 von Böhmen. Besiedlung unserer Gegend durch die Franken und Thüringer.
Diese brachten auch den Schiefer für die Häuser in die Oberlausitz.
1253 bis 1319
Unser Gebiet wird der Mark Brandenburg zugeschlagen. Dies hatte die Aufteilung der Oberlausitz zur Folge. Im Ergebnis dessen gelangte die Oberlausitz ab 1346 zu Böhmen. Beide Schweidnitz gehörten allerdings bereits seit 1329 zu Böhmen.
1306 - Groß- und Kleinschweidnitz
Groß- und Kleinschweidnitz wurden erstmals 1306 urkundlich als zwei getrennte Dörfer erwähnt.
Der als Waldhufenort gegründete Ort Großschweidnitz zieht sich in der Talaue des Großschweidnitzer Wassers vom Höllengrund bis zur Grenze Kleinschweidnitz hin. Er ist von Grünflächen sowie umfangreichem und z.T. altem Baumbestand durchsetzt.
1478 bis 1800
Die Stadt Löbau kauft Zinsanteile von Großschweidnitz.
Groß- und Kleinschweidnitz behalten ihre Selbstständigkeit. Das Leben war geprägt durch Kriege und Hungersnöte, aber auch sich entwickelndes Gewerbe sowie Landwirtschaft und Gartenbau.
18. und 19. Jahrhundert
Das sich nach Nordosten anschließende Gebiet von Kleinschweidnitz hat unregelmäßige, ungleiche und blockartige Grundstücke mit verstreut liegenden Häusern.
Großschweidnitz war ursprünglich ein reines Bauerndorf, zudem im 18. und 19. Jahrhundert das Mühlenhandwerk kam.
In Groß- und Kleinschweidnitz gab es zwölf Wassermühlen und eine Windmühle, aber kaum den Erwerbszweig der Handweberei.
Über drei Jahrhunderte wurde das dörfliche Leben durch zwei Rittergüter geprägt. Das Ortsbild von Großschweidnitz ist vielgestaltig und spiegelt in der Bebauung die Entwicklung des Dorfes wider.
1869 - 1904
Mit dem Bau der Duncan's Leinenindustrie 1869/70 und Heil- und Pflegeanstalt (heute Sächsisches Krankenhaus) von 1902 bis 1904 kam es verstärkt zum Häuser- und Siedlungsbau und damit auch zum Bevölkerungszuwachs von Groß- und Kleinschweidnitz. Die Heil- und Pflegeanstalt selbst wurde im Pavillionstil auf einem etwa 30ha großen Areal errichtet. Die gelben Klinker- und andere Bauten des Krankenhauses stehen in einer weitestgehend zaunlosen Parklandschaft.
Die im Jahr 1904 fertiggestellte und in den letzten Jahren umfassend rekonstruierte Kirche prägt maßgeblich das Dorfbild. Die Entstehung des Bleichereibetriebes und der Anstalt veränderte die Bevölkerungsstruktur des Dorfes wesentlich. Immer mehr Industriearbeiter, Krankenhauspersonal und Gewerbetreibende wurden ansässig.
1937
1937 erfolgte der Zusammenschluß der beiden Gemeinden Groß- und Kleinschweidnitz zur Gemeinde Großschweidnitz mit einer zentral gelegenen Gemeindeverwaltung.
Die neue Gemeinde hieß dann nur noch Großschweidnitz (ohne Ortsteil).
Die Ortsbevölkerung kann die ansässige Zahnarztpraxis, die allgemeinmedizinische Sprechstunde und die Physiotherapie des Krankenhauses in Anspruch nehmen.
Im Ort gibt es den Seniorenverein, den Schützenverein, die Sportgemeinschaften Medizin und GSC 99.
1993
Nach 1993 entstand in Großschweidnitz ein großes Neubaugebiet mit 40 Häusern in der Ortsmitte unweit der Straße Löbau/Neugersdorf.
Auf einem angrenzenden und bereits erschlossenen Standort besteht die Möglichkeit zum Bau weiterer Häuser.
Im Südwesten von Großschweidnitz grenzt der 800 m lange "Höllengrund" an. Hier hat sich das Wasser von Millionen vor Jahren in das Granitmassiv eingesägt und damit ein bewaldetes Tal geschaffen, das Anziehungspunkt für viele Spaziergänger von nah und fern ist.
Im vergangenen Jahr wurde das im Höllengrund stehende Waldhaus durch den Verein "Waldhaus e.V." rekonstruiert und soll dem Ort zweckgebunden zur Verfügung stehen. Vom Ort aus besteht Busverbindung nach Löbau und Neugersdorf.
Im dörflichen Bild treten solche Baulichkeiten, wie das gesamte Krankenhausensemble, die Herrengebäude der beiden Rittergüter, das Eisenbahnviadukt, das Gebäude der Gemeindeverwaltung und die Duncan-Villa besonders in Erscheinung.
Großschweidnitz wird von zwei Wanderwegen berührt und zwar vom Naturlehrpfad rund um Löbau sowie im Bereich des Höllengrundes vom Wanderweg nach Lawalde und Schönbach.
1996 bis 1998
Erschließung des Wohnbaugebietes “Mitte II” mit 39 Grundstücken.
Bau des Klärwerkes am Langen Steg und Verlegung der Abwasserkanäle im Ort. In diesem Zusammenhang werden in vielen Bereichen des Ortes Strom-, Telefon-, Erdgas-, Trinkwasser- und Straßenlichtleitungen neu verlegt bzw. erneuert.
Bürgermeister ab 1921
- Alwin Micklisch von 1921 bis 1935 Er war der letzte Bürgermeister von Kleinschweidnitz.
- Kurt Reinhold 1929 – 1935 Er war der letzte Bürgermeister von Großschweidnitz
Alwin Micklisch und Kurt Reinhold waren von 1936-1938 gemeinsam Bürgermeister von Großschweidnitz.
- Emil Dehner von 1924 - 1928
- Paul Penther von 1938 - 1945
- Theodor Pappert von 1945 - 1956
- Heinz Richter von 1956 - 1970
- Rudolph Pelz von 1970 - 1983
- Heinz Hartmann von 1983 - 1984
- Klaus Kirsche von 1984 - 1994
- Thomas Konietzny von 1994 - 2008


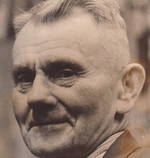

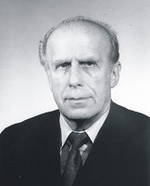



Duncanschen Leinenindustrie Großschweidnitz
Vom Entstehen der Duncanschen Leinenindustrie Großschweidnitz
Gegründet wurde der Betrieb durch den Engländer Sir William Duncan in den Jahren 1869/70.
Duncan besaß bis dahin eine Leinengarnbleiche und einen Leinengarnhandel in Rawdon bei Leeds in England.
In den Oberlausitzer Leinenwebereien wurden die gebleichten Leinengarne zu billiger Ware für den Export nach Amerika weiterverarbeitet.
Mitte der 60er Jahre des 19. Jahrhunderts stellten viele englische Lieferanten ihre Geschäfte nach Sachsen infolge des Krieges ein. Diese politischen Schwierigkeiten haben Duncan veranlaßt, seine Fabrik in die Oberlausitz zu verlegen.
Für den Standort Großschweidnitz entschied er sich, weil er hier geeignetes Wasser, ausreichend viel und erfahrene Arbeitskräfte sowie 74ha Land und Bleichwiesen durch den Ankauf von drei Bauerngütern vorfand.
Für die Standortwahl waren ferner die günstige Verkehrslage an der 1828/29 gebauten Straße Löbau/Rumburg und die 1848 eingeweihte Eisenbahnstrecke Löbau/Zittau ausschlaggebend.
Gewerberecht in Großschweidnitz
Am 20.09.1870 erhielt Duncan im Alter von knapp 40 Jahren das Gewerberecht in Großschweidnitz. das war die Geburtsstunde des Betriebes mit dem Namen "Duncan's Leinenindustrie". Der Betrieb wurde auch "englische Bleiche" genannt, woraus in der Umgangssprache die Bezeichnung "Engelei" entstand.
Weitere Entwicklung des Unternehmens
Die Entwicklung des Unternehmens führte zu einem enormen Wachstum der Beschäftigten, was den Ort Großschweidnitz, ein bisher ruhiges Bauern- und Mühlendorf, sozial prägte. I
Im Jahre 1905 wurde der Betrieb in eine Aktiengesellschaft mit dem Namen »Duncan's Leinenindustrie AG« umgewandelt. In den Jahren 1890-1923 entstanden ein neues Zwirnereigebäude, ein Erweiterungsbau der Bleicherei, das Maschinenhaus mit einem 72,5m hohen Schornstein und das Bürogebäude. Mit 579 Arbeitskräften erreichte der Betrieb kurz vor dem 1. Weltkrieg seine höchste Belegschaftsstärke.
Im Zuge der Weltwirtschaftskrise gelang es der Konkurrenzfirma Gruschwitz aus Neusalz/Oder die Aktienmehrheit der Duncan-AG und damit das Entscheidungsrecht über den Betrieb zu erhalten.
Nach 1945 wurde die Firma in sozialistisches Eigentum überführt und an das Kombinat "Hirschfelder Leinen- und Textilindustrie" angegliedert. 1990 wurde der Betrieb geschlossen (wurde Treuhandvermögen) und 1995 - 96 fast vollständig abgerissen.
